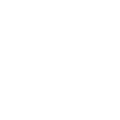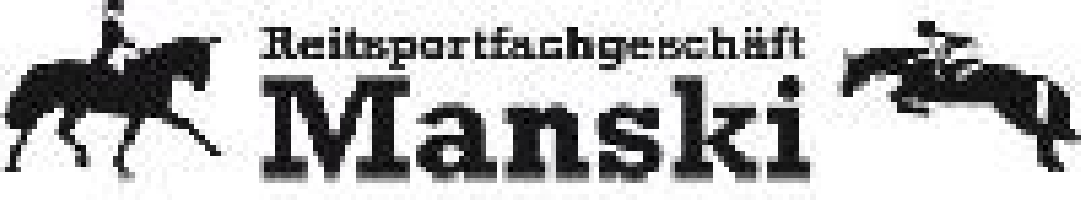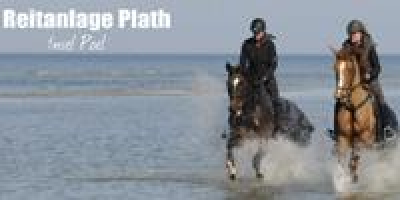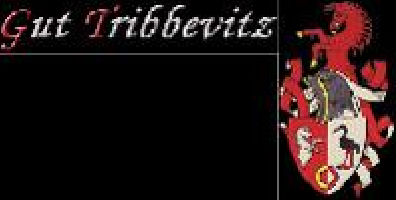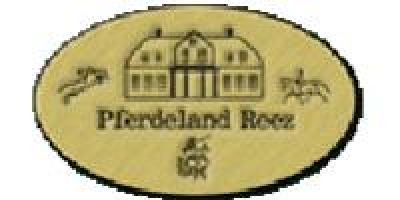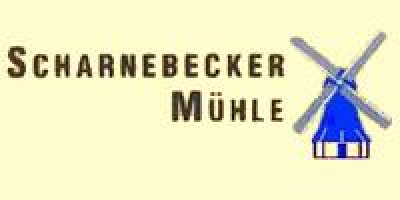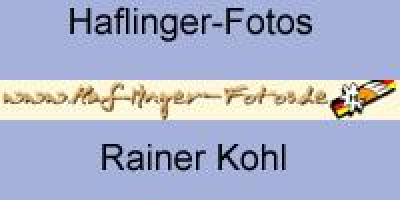Tierärztliche Aufklärungspflicht
Erschienen am 05.05.2023

An einen Tierarzt werden bezüglich der Aufklärungspflicht gegenüber dem Pferde-eigentümer deutlich geringere Anforderungen gestellt als an den Human-mediziner im Verhältnis zum Patienten. Der wesentliche Grund liegt darin, dass der humanmedizinische Eingriff überhaupt nur gerechtfertigt ist, wenn der Patient über Art und Risiko der Maßnahme umfassend informiert ist. Nur dann kann er wirksam einwilligen mit der rechtlichen Konsequenz, dass der Arzt rechtmäßig handelt.
Grundsätze
In der Humanmedizin begeht der behandelnde Tierarzt eine Körperverletzung, wenn der Patient nicht in den chirurgischen Eingriff eingewilligt hat. Diese Einwilligung wiederum ist überhaupt nur dann wirksam, wenn sie auf einer umfassenden Aufklärung beruht, die dem Patienten die Entscheidung ermöglicht, ob er die bestimmte Behandlung wünscht.
In der Behandlung von Pferden ist jeweils der Eigentümer der Ansprechpartner, der den Tierarzt damit beauftragt, das Pferd zur Erhaltung seines Lebens oder zur Beseitigung des Krankheitszustandes zu untersuchen und zu behandeln. Der erteilte Auftrag rechtfertigt die vom Tierarzt durchzuführende Therapie. Die Verletzung der Aufklärungspflicht kann allerdings dazu führen, dass die durchgeführte Maßnahme nicht vom Auftrag gedeckt ist. Dann kann der tierärztliche Honoraranspruch entfallen, wenn erwiesen ist, dass bei sachgerechter Aufklärung der Pferdebesitzer den Auftrag nicht erteilt bzw. die Behandlung abgelehnt hätte. Voraussetzung wäre allerdings, dass von ihm glaubhaft gemacht wird, dass er sich über eine Empfehlung hinweggesetzt hätte. Zunächst wäre nämlich davon auszugehen, dass der Auftraggeber sich „beratungskonform“ verhalten hätte, dem tierärztlichen Rat also gefolgt wäre.
Zudem kann die Verletzung der Aufklärungspflicht auch zum Schadensersatz führen. Das ist dann der Fall, wenn die tatsächlich durchgeführte Therapie einen Schaden herbeiführt und glaubhaft gemacht wird, dass bei richtiger Aufklärung das Risiko der durchgeführten Therapie nicht in Kauf genommen worden wäre.
Ein Beispielsfall
Ein hochwertiges Dressurpferd, hatte beim morgendlichen Training einmalig gehustet. Der darüber unterrichtete Tierarzt führte zur Stärkung des Immunsystems des Pferdes und mit dem Ziel, eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verhindern, eine Behandlung mit aufbereitetem Eigenblut unter Verwendung von homöopathischen Substanzen durch. Obwohl das Pferd in der Vergangenheit bereits mehrfach eine vergleichbare Behandlung erfahren hatte, erlitt es einen anaphylaktischen Schock und verendete.
Die Aufklärungspflicht
An die tierärztliche Aufklärungspflicht werden hohe Anforderungen gestellt, wenn der durchzuführende Eingriff nicht dringend ist. Zudem sind die Anforderungen dann besonders hoch, wenn die Erfolgsaussichten der durchzuführenden Therapie zweifelhaft sind.
Das Oberlandesgericht München I (1 U 3011/19) hat einen Grundsatz formuliert, wonach die tierärztliche Aufklärungspflicht grundsätzlich erfordert, den Auftraggeber über die Behandlungsmethoden, ihre Erfolgsaussichten und Risiken und gegebenenfalls auch über in Betracht kommende Behandlungs-alternativen zu beraten. Art und Umfang der Aufklärungspflicht hätten sich im Einzelfall nach den für den Tierarzt erkennbaren Interessen seines Auftraggebers und nach dessen besonderen Wünschen zu richten, wobei auch der materielle oder ideelle Wert des Pferdes eine Rolle spielen könne. Das OLG ist davon ausgegangen, dass die vom Tierarzt durchgeführte Behandlung einer Stärkung des Immunsystems jedenfalls nicht zwingend notwendig und dringlich war. Weil die Behandlung einem sehr wertvollen Pferd galt, an welchem deren Eigentümerin ein erhebliches ideelles Interesse hatte, musste der Tierarzt auch darauf aufmerksam machen, das mit der Behandlung – durchaus sehr seltene – Risiko einer anaphylaktischen Reaktion mit tödlichem Ausgang nicht auszuschließen sei.
Die Konsequenz
Wenn davon auszugehen ist, dass bei sorgfältiger Aufklärung der Pferdeeigentümer der beabsichtigten Therapie nicht zugestimmt hätte, hat der Tierarzt Schadensersatz zu leisten in Höhe des Wiederbeschaffungswertes des behandelnden Pferdes.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt / Fachanwalt