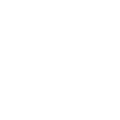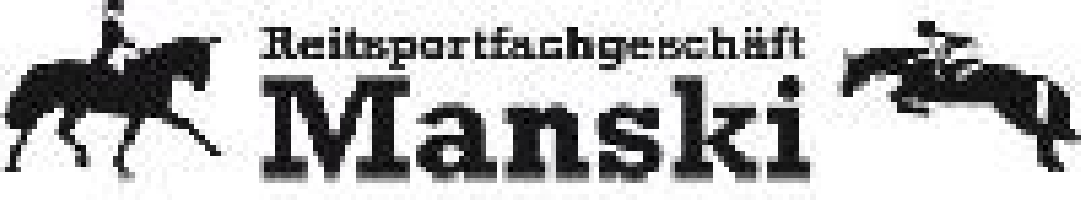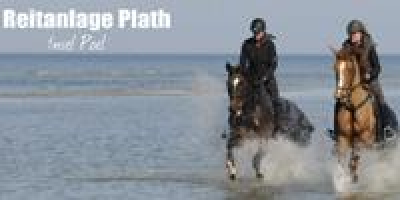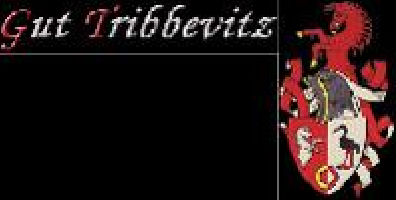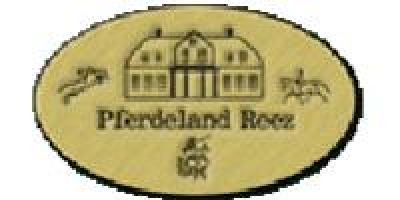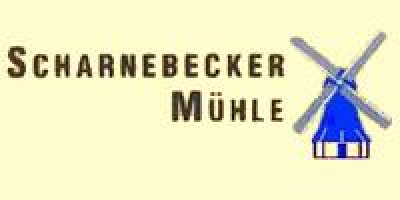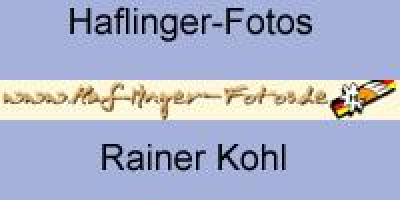Wissenwertes: Beendigung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft – Wer bekommt das Pferd?
Erschienen am 10.10.2025

Für nichteheliche Lebensgemeinschaften fehlt es an gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Rechtsfolgen einer Trennung. Das gilt nicht nur für finanzielle Ansprüche, sondern auch für die Nutzung eines gemeinsam erworbenen Pferdes und die Auflösung der Miteigentümergemeinschaft.
Für den Fall der Trennung von Eheleuten und deren Scheidung gibt es gesetzliche Regeln, die auch die Aufteilung gemeinschaftlicher Haushaltsgegenstände umfassen. Die gelten auf der Basis von § 90 a BGB anlog auch für Tiere. Diese gesetzlichen Bestimmungen sind aber nicht vorgesehen und auch nicht analog übertragbar auf die Folgen der Beendigung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
Die Konfliktlage
Unproblematisch ist ein Fall bezüglich eines Pferdes nach Auflösung einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft dann, wenn einer der Lebenspartner das Pferd allein gekauft und übereignet bekommen hat. Der Eigentümer hat die uneingeschränkte Verfügungsmacht über das Pferd. Er hat daher auch die Berechtigung, gegen den Willen des vormaligen Lebenspartners das Pferd zu veräußern oder allein zu nutzen. Es entspricht aber der Lebenserfahrung, dass beide Partner das Pferd gemeinsam kaufen und daher Miteigentümer werden, solange die nichteheliche Lebensgemeinschaft funktioniert.
Vollzieht ein Partner dann die räumliche Trennung und verändert ohne Zustimmung des anderen den Standort des Pferdes, handelt es sich um verbotene Eigenmacht. Die berechtigt dann den verlassenen Miteigentümer, im Wege einer einstweiligen Verfügung das Pferd herauszuverlangen und am vormaligen Standort zu belassen bis zu einer endgültigen Auseinandersetzung.
Stillschweigender Verzicht
Man könnte auf die Idee kommen, dass der Partner, der auszieht, ohne sich Ansprüche an dem zurückgelassenen Pferd vorzubehalten, quasi stillschweigend den Verzicht auf sein Eigentum erklärt. Diese Einschätzung wäre rechtlich allerdings nicht haltbar, weil generell davon auszugehen ist, dass beide Parteien ihre Eigentumsrechte aufrechterhalten wollen. Deswegen sollte bei der Beendigung einer Lebensgemeinschaft eine Einigung speziell über den Standort und die Nutzung des Pferdes getroffen werden. Dadurch würde der Streit vermieden werden, der sich dann ergibt, wenn nur einer der vorherigen Lebenspartner ein Interesse an der Nutzung des Pferdes hat, während der andere einen Verkauf bevorzugen würde. Ein Streitpunkt könnte die Nutzung des Pferdes auch dann sein, wenn beide Ex-Partner reiterliche Interessen verfolgen. Dann empfiehlt sich eine genaue zeitliche Festlegung und auch eine Einigung darüber, in welchem Verhältnis die anfallenden laufenden Kosten getragen werden sollen. Kommt keine Einigung zustande, bleibt als letzte Möglichkeit nur die Auseinandersetzung der Miteigentümergemeinschaft. Die kann auf gesetzlicher Grundlage (§ 749 Abs. I BGB) jederzeit verlangt werden.
Die Auseinandersetzung
Bei einem Pferd scheidet selbstverständlich eine „Aufteilung in Natur“ aus. Eine solche Auseinandersetzungsmöglichkeit käme allenfalls bei Schlachttieren in Betracht.
Das Gesetz sieht in § 753 Abs. 1 BGB den Verkauf eines im gemeinsamen Eigentum stehenden Vermögenswertes und die Teilung des erzielten Erlöses vor. Dieser Auseinandersetzung der Miteigentümergemeinschaft gemäß der gesetzlichen Vorgabe kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass einer der Partner eine stärkere emotionale Bindung an das gemeinsame Pferd hat. Einigen sich die Parteien nicht über einen Verkauf, kann – auch gegen den Willen des anderen Miteigentümers – die öffentliche Versteigerung veranlasst werden. Damit würde entweder ein Gerichtsvollzieher oder ein öffentlich bestellter Versteigerer beauftragt. Der wird jedenfalls dann, wenn sich die Miteigentümer nicht auf einen Wert einigen können, ein Gutachten zum Wert einholen, um ein Mindestgebot festlegen zu können. Der beauftragte Versteigerer würde dann auch noch zumindest in der örtlichen Presse den Versteigerungstermin und den Gegenstand der Versteigerung veröffentlichen. Der Erlös würde dann nach Abzug der Versteigerungskosten zwischen den Miteigentümern aufzuteilen sein. Die Versteigerung kann zu einem unbilligen Ergebnis führen, weil möglicherweise der finanziell stärkere Partner das Pferd erwirbt, obwohl es in der Vergangenheit dem anderen Partner zur Ausübung seines reitsportlichen Hobbys zur Verfügung stand.
Das Gesetz sieht für den Fall der Trennung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und die Versteigerung des Pferdes im Rahmen einer streitigen Auflösung der Miteigentümergemeinschaft keine Berücksichtigung emotionaler Gesichtspunkte vor, auch keine Praktikabili-tätserwägungen. Dennoch ist die einzig rechtskonforme Lösung die Versteigerung, sofern es nicht zu einer Einigung über einen gemeinschaftlichen Verkauf und die Teilung des Erlöses kommt. Gerade deswegen ist den Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft dringend zu raten, eine einvernehmliche Lösung zu treffen.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt/Fachanwalt