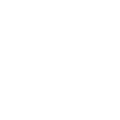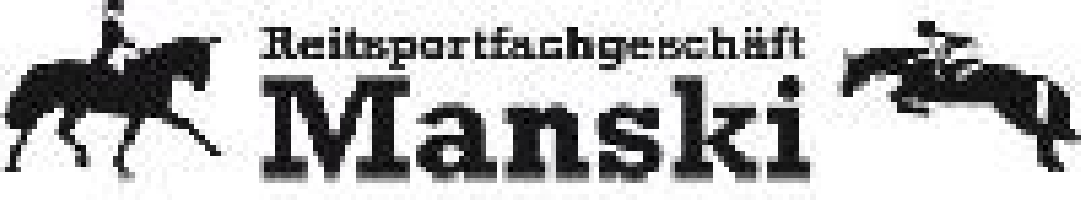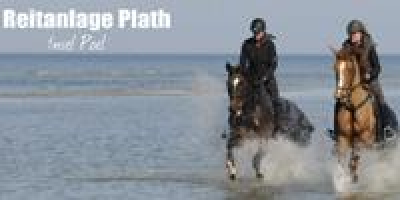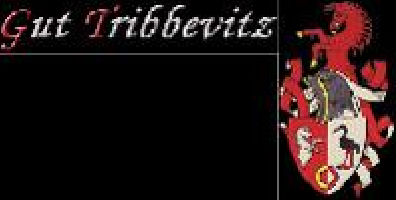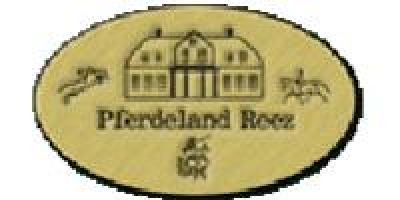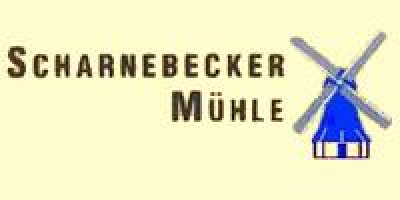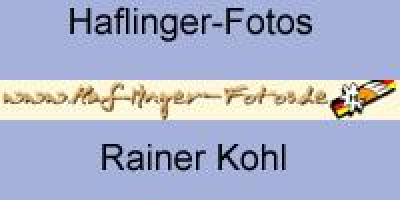Wer ist Verkäufer bei einer Auktion – der Auktionator oder der Beschicker?
Erschienen am 05.12.2024

Wenn der Käufer eines Pferdes nach einem Auktionskauf Mängelansprüche geltend machen will, stellt sich die Frage, gegen wen die zu richten sind. Die Beantwortung ist gar nicht so einfach, wie der Meistbietende denken würde.
Öffentliche Versteigerung von Pferden
Bei der Auktion von Reitpferden, Hengsten und Fohlen finden sich im Wesentlichen zwei Modalitäten:
In den meisten Auktionsbedingungen werden die angebotenen Tiere im Namen des Ausstellers oder Beschickers angeboten und verkauft. Abhängig davon, ob es sich um ein gewerbliches, ein landwirtschaftliches oder privates Geschäft handelt, ist dann auch der Mehrwertsteuersatz angegeben, um den sich der Zuschlagspreis erhöht. Alternativ gibt es auch Auktionen, in denen der Veranstalter die Pferde im eigenen Namen verkauft. Der tritt dann als Kommissionär auf. Bei einem Kommissionsgeschäft handelt der Verkäufer im eigenen Namen auf fremde Rechnung. Ansprüche wegen eventueller Mängel richten sich dann gegen den Kommissionär.
Auslegungsfrage?
Das Landgericht Oldenburg (LG) hatte sich mit einer öffentlichen Versteigerung zu befassen, die als Hofauktion durchgeführt wurde. In deren Auktionsbedingungen hat sich der öffentlich bestellte und vereidigte Versteigerer als Veranstalter der Versteigerung angegeben und mitgeteilt, dass er ausschließlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Versteigerung nach den von ihm gestellten Bedingungen hafte.
Weiter heißt es in den Bedingungen wörtlich:
Der Versteigerer ist – auch ohne Angabe von Gründen – berechtigt, Gebote abzulehnen, Angebote zur Auktion zurückzuziehen, verschiedene Katalognummern zu vereinen oder auf mehrere aufzuteilen. Er ist in begründeten Fällen berechtigt, den Zuschlag zurückzunehmen und die Katalognummer erneut anzubieten. Jedes Gebot auf eine Katalognummer stellt ein rechtsverbindliches Angebot an den Versteigerer zum Abschluss eines Kaufvertrages dar… Mit der in Verbindung mit dem Zuschlag zum Auktionator ausgesprochenen Willenserklärung der Annahme des Höchstgebotes kommt ein im Wege einer Versteigerung geschlossener Kaufvertrag zwischen dem Bieter und dem Versteigerer zustande (§ 156 BGB).
Die Klägerin machte einen Minderungsanspruch wegen eines behaupteten Mangels des von ihr ersteigerten Pferdes geltend. Die Klage richtete sich gegen den Auktionator, der sich in den Auktionsbedingungen, die von ihm gestellt wurden, selbst als solcher bezeichnet hat, daneben auch als Veranstalter der Auktion. Zudem hieß es unter der Überschrift „Versteigerungsbedingungen“, dass der mit der Nutzung des Auktionsangebotes die Auktionsbedingungen akzeptiert würden. Insoweit sind also Versteigerung und Auktion zwar nicht wortgleich, aber inhaltlich synonym verwendet worden. Dasselbe gilt für die vorstehenden Auktionsbedingungen. Denn sicherlich konnte man unter dem Begriff „Versteigerer“ nicht den jeweiligen Beschicker oder Eigentümer des Pferdes erkennen, weil der weder berechtigt war, Gebote abzulehnen oder Angebote aus der Auktion zurückzuziehen, weil der Ablauf der Versteigerung ausschließlich in Händen des Auktionators/Versteigerers lag.
Die Klägerin war daher in der Klage davon ausgegangen, dass der Verkauf im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts erfolgt war, in welchem der Auktionator im eigenen Namen, aber auf fremde Rechnung handelte.
Das LG teilte diese rechtliche Einschätzung nicht. Im Gegenteil: Es meinte, dass der Beklagte als Auktionator erkennbar im Namen seines Auftraggebers, also des Eigentümers der angebotenen Pferde gehandelt habe. Das der Auktionator lediglich Veranstalter sein und die Pferde nicht im eigenen Namen verkaufen wollte, ergäbe sich schon daraus, dass er nach den Versteigerungsbedingungen die Auktion im Auftrag des Hofeigentümers durchgeführt habe und ausschließlich für die ordnungsgemäße Durchführung der Versteigerung „nach diesen Bedingungen“, mithin nicht für die verkaufte Sache hafte.
Wirklich überzeugend erscheint dieses Argument nicht. Schließlich ist der Auktionator in zwei Funktionen aufgetreten, einmal als Veranstalter der Auktion, zum anderen eben in der Funktion als Auktionator, auch als Versteigerer bezeichnet. Erst recht kommen Zweifel auf, wenn das LG argumentiert, es sei in den Auktionsbedingungen klargestellt, dass sich die Gebote zum Abschluss eines Kaufvertrages „an den Versteigerer“ richteten und der Kaufvertrag zwischen dem „Bieter und dem Versteigerer“ zustande kommen sollte und gerade nicht mit dem Beklagten als „Auktionator bzw. Veranstalter“. Aus der Sicht eines verständigen Bieters seien die in den Auktionsbedingungen verwendeten Begriffe des „Veranstalters“ und des „Versteigerers“ nicht gleichbedeutend. Dem ist durchaus zuzustimmen. Der Auktionator war zum einen Veranstalter und insoweit im Auftrag des Hofeigentümers tätig, andererseits aber auch Auktionator. Der Begriff „Auktionator“ ist inhaltlich mit dem des „Versteigerers“ identisch. Das LG Düsseldorf allerdings meinte, durch Zuschlag sei ein Vertrag zwischen „dem Veranstalter/Auktionator auf der einen Seite und dem Verkäufer/Versteigerer auf der anderen Seite“ zustande gekommen.
Befremdendes Ergebnis
Der Begriff „Versteigerung“ ist von seiner Bedeutung gleichbedeutend mit dem Begriff „Auktion“. Es ist deswegen naheliegend, wohl nur logisch, dass die Bezeichnung als „Auktionator“ nichts anderes ist als der „Versteigerer“. Legt man also „diese Bedingungen“ als Teil der Auktionsbedingungen zugrunde, wäre der Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer/Auktionator und dem Meistbietenden zustande gekommen. Nach traditionellem Verständnis von Kaufinteressenten, die bei einer Reitpferdeauktion Gebote abgeben, sind sie selbst sicherlich nicht Versteigerer, sondern die Person, die den Zuschlag erteilt, also der Auktionator/Versteigerer. Die Tatsache, dass der Auktionator zugleich auch als Veranstalter der Auktion auftritt, beschreibt lediglich eine Doppelfunktion, kann aber aus dem Eigentümer nicht den Versteigerer machen.
Fazit
Grundsätzlich gehen inhaltliche Unklarheiten zulasten des Verwenders von Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auch unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes erscheint die Entscheidung des LG Düsseldorf nicht überzeugend.
Dr. Dietrich Plewa
Rechtsanwalt / Fachanwalt