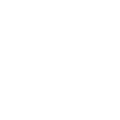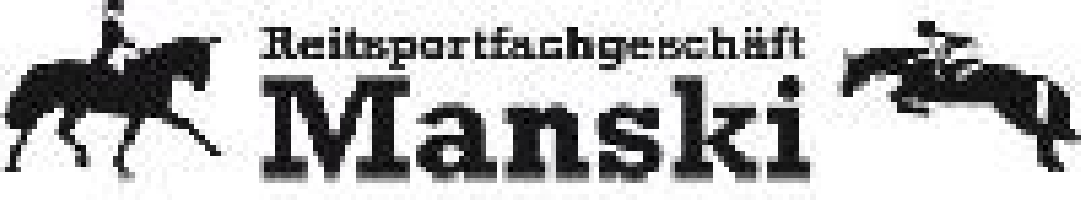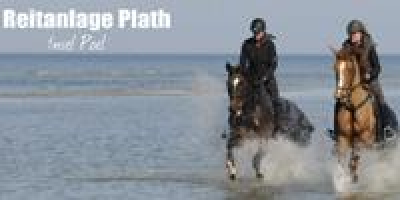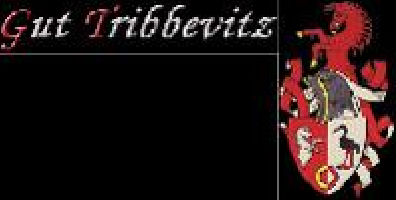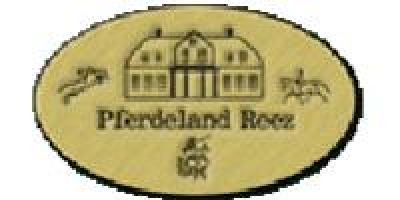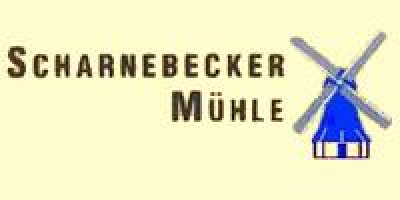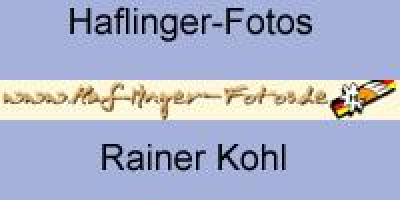Was ist bei einer „Reitbeteiligung" zu beachten?
Erschienen am 10.05.2016
 Nicht jeder kann oder will sich ein eigenes Pferd leisten, wohl aber seinem reitsportlichen Hobby nachgehen. Manche Pferdehalter wiederum haben nicht ausreichend Zeit, sich ihrem Pferd täglich zu widmen. Treffen diese Positionen aufeinander, bietet sich eine Reitbeteiligung an, man könnte sie auch "Horse-Sharing" nennen. Dieser Beitrag versucht, in Stichworten, Fragen und Antworten, Tipps für ein "harmonisches Miteinander" zu geben.
Nicht jeder kann oder will sich ein eigenes Pferd leisten, wohl aber seinem reitsportlichen Hobby nachgehen. Manche Pferdehalter wiederum haben nicht ausreichend Zeit, sich ihrem Pferd täglich zu widmen. Treffen diese Positionen aufeinander, bietet sich eine Reitbeteiligung an, man könnte sie auch "Horse-Sharing" nennen. Dieser Beitrag versucht, in Stichworten, Fragen und Antworten, Tipps für ein "harmonisches Miteinander" zu geben.
Die Ausgangslage
Eine Reiterin, nennen wir sie R, hat kein eigenes Pferd, möchte aber zwei- bis dreimal pro Woche gerne reiten, ohne unbedingt an einer offiziellen Reitstunde teilzunehmen. Die Pferdehalterin H hat keine Zeit, ihrem Pferd täglich Bewegung zu verschaffen. Ihr ist es recht, wenn eine zuverlässige "Reitbeteiligung" sich an einigen Tagen pro Woche um das Pferd kümmert. Das bedeutet: H vereinbart mit R, dass die in einem festgelegten Umfang, beispielsweise an drei Tagen pro Woche, das Pferd P reiten darf.
Die Modelle
Inhaltlich trifft man regelmäßig folgende Vereinbarungen an:
1. R beteiligt sich mit einem pauschalen Betrag an den laufenden Unterhaltungskosten des Pferdes bzw. bezahlt schlicht eine festgesetzte Summe pro Monat als Gegenleistung für das Recht, das Pferd in einem bestimmten Umfang neben H nutzen zu dürfen.
Vorteil: Klare Regelung, zu zahlender Betrag unabhängig von den tatsächlich anfallenden Kosten.
Nachteil: keine Beteiligung an Kosten, die über die gewöhnlichen Unterhaltungsaufwendungen hinausgehen, z.B. Hufschmied oder Tierarzt.
2. R zahlt an H einen bestimmten Prozentsatz, z.B. 50 %, der monatlich tatsächlich anfallenden Kosten.
Vorteil: ausgewogene Kostenverteilung, insbesondere dann, wenn R Pferd in gleichem Umfang nutzt wie H.
Nachteil: ständig variierende Höhe, monatliche Abrechnung erforderlich, bei außergewöhnlichen Kosten wird R Reitbeteiligung kündigen.
3. R zahlt kein Geld, sondern erbringt bestimmte Leistungen, z.B. Ausmisten, Einstreuen, sonstige Pflegeleistungen auch an den Tagen, an denen R das Pferd nicht reitet.
Vorteil: Zeitliche Entlastung des H, kein "Streit ums Geld".
Nachteil: keine finanzielle Entlastung des H, möglicher Streit über die Qualität der zu erbringenden Arbeitsleistungen.
Der Vertrag
Die Reitbeteiligung ist grundsätzlich formfrei wirksam, empfehlenswert aber: schriftlicher Vertrag
Vertragsinhalt
1. Der Umfang des Rechts der R zur Mitbenutzung ist möglichst exakt festzulegen, z.B. nach Anzahl der Wochentage und/oder unter Benennung der Tage. Es sind Einschränkungen zu vereinbaren, z.B. keine Ausritte ins Gelände, Springstunden nur unter Aufsicht, zeitlicher Umfang der reiterlichen Nutzung, z.B. nicht mehr als eineinhalb Stunde/Tag.
2. Art und Höhe der Gegenleistung sind entsprechend einem der Modelle 1 bis 3 zu vereinbaren; außerdem: Vereinbarung der Fälligkeit, z.B. monatlich im Voraus. Bei Arbeitsleistung möglichst genaue Beschreibung.
3. Haftung des H
Da R das Pferd wie ein Eigentümer nutzt, sollte die Haftung des H als Tierhalter ausgeschlossen werden, soweit nicht die Tierhalterhaftpflichtversicherung eintrittspflichtig ist. Für R empfiehlt sich wie für jeden Reiter eine private Unfallversicherung.
4. Haftung des R
Nach dem Gesetz haftet R für jeden von ihm zumindest fahrlässig verursachten Schaden an dem Pferd, allerdings müsste das Verschulden von H nachgewiesen werden. Die gesetzliche Regelung erscheint interessensgerecht, so dass eine gesonderte Vereinbarung nicht erforderlich ist.
5. Dauer
Üblicherweise werden Reitbeteiligungen unbefristet vereinbart. Sie können dann jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen von H oder R gekündigt werden.
Vorteil für H: Bei Unzufriedenheit Möglichkeit einer sofortigen Beendigung, ebenso dann, wenn "Eigenbedarf' besteht
Vorteil für R: Bei Verhinderung wegen Krankheit von R oder Pferd P keine Pflicht zur Kostentragung. Eventuell gezahlter Betrag müsste anteilig zurückgezahlt werden. Bei Streit sofortige Ausstiegsmöglichkeit, ebenso bei Wohnungswechsel etc.
Nachteil für H: Insbesondere bei prozentualer Kostenbeteiligung, z.B. nach Erkrankung des Pferdes, Belastung mit den im betreffenden Monat insgesamt anfallenden Kosten; keine Übergangszeit, um andere Reitbeteiligung zu suchen.
Nachteil für R: Keine Übergangszeit, um anderweitig Reitmöglichkeit zu erwerben.
Vorschlag: Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende; für Kündigungserklärung Schriftform vereinbaren.
Noch besser: Einvernehmlich die Reitbeteiligung beenden.
Versicherung
Jeder Pferdehalter sollte eine Tierhalterhaftpflichtversicherung haben im Hinblick auf das erhebliche Haftungsrisiko, das sich aus § 833 BGB, der Tierhalterhaftung, ergibt. Bei einer Reitbeteiligung handelt es sich nach Auffassung der Versicherungsgesellschaften um einen Gefahr erhöhenden Umstand. Der sollte deswegen vorsorglich dem Versicherer gemeldet werden. Einer Erhöhung der Versicherungsprämie ist zu widersprechen, weil tatsächlich das Risiko nicht erhöht wird, weil das Pferd ja nicht doppelt, sondern nur von zwei verschiedenen Personen genutzt wird. Es sollte von der Versicherung verbindlich erklärt werden, dass R für den Fall eines durch das Pferd verursachten Schadens Versicherungsschutz genießt.
Achtung: Die Gerichte verneinen bei einer längerfristig privat vereinbarten Reitbeteiligung teilweise den Versicherungsschutz der Tierhalterhaftpflichtversicherung, weil sie die R als Mit-Pferdehalterin ansehen, daher die dringende Empfehlung, in jedem Fall eine private Unfallversicherung abzuschließen.
Sonstiges
Alle rechtlichen Empfehlungen nützen nichts, wenn H und R nicht zusammen passen, also die Atmosphäre beeinträchtigt ist. Es hat sich bewährt, zunächst eine kurze Probezeit zu vereinbaren, auch zu dem Zweck, H und R die Feststellung zu ermöglichen, ob man persönlich miteinander harmoniert, aber auch, ob das Pferd P Freude an R hat und umgekehrt.
Dr. Plewa/Dr. Schliecker Rechtsanwälte