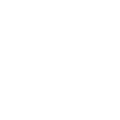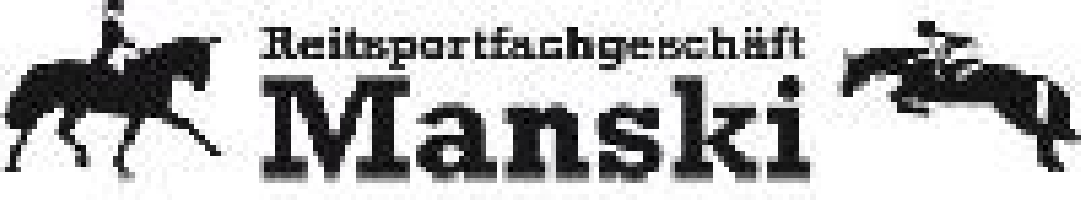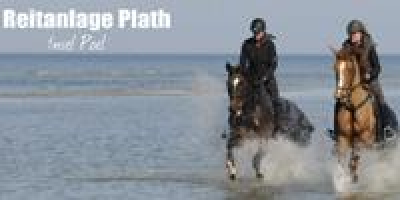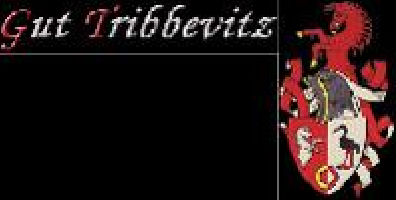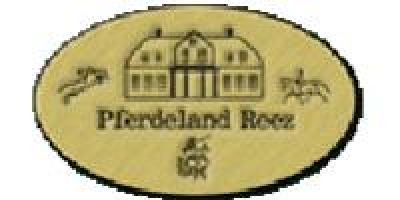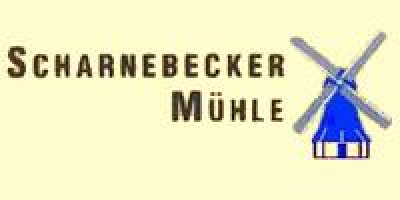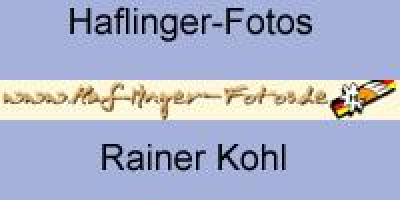Die tierärztliche Aufklärungspflicht
Erschienen am 01.06.2013
 Oft wird in Haftpflichtprozessen gegen Tierärzte das Argument gebraucht, der Pferdeeigentümer sei nicht ausreichend über die Risiken der durchgeführten Operations- oder Behandlungsmethode aufgeklärt worden. Dieser Beitrag befasst sich am Beispiel eines konkreten Falls mit den Gründen dafür, warum die Aufklärungsrüge kaum einmal erfolgreich ist.
Oft wird in Haftpflichtprozessen gegen Tierärzte das Argument gebraucht, der Pferdeeigentümer sei nicht ausreichend über die Risiken der durchgeführten Operations- oder Behandlungsmethode aufgeklärt worden. Dieser Beitrag befasst sich am Beispiel eines konkreten Falls mit den Gründen dafür, warum die Aufklärungsrüge kaum einmal erfolgreich ist.
Der Fall
Der Kläger eines vom Landgericht Saarbrücken (LG) entschiedenen Rechtsstreites hatte den beklagten Tierarzt mit der Zahnbehandlung seines Pferdes beauftragt. Es wurde ein verkeilter Backenzahn (Milchzahn) extrahiert. Weil dann aus der im Unterkiefer verbliebenen Wunde Eiter austrat, wurde das Pferd nochmals behandelt. Es wurden nunmehr zwei bleibende Backenzähne entfernt. Später stellte sich heraus, dass das Pferd eine Fraktur des Unterkiefers erlitten hatte im Bereich der gezogenen Backenzähne. Das Pferd wurde schließlich - in einer anderen Tierklinik - euthanasiert, weil dort die Prognose als infaust angesehen wurde.
Der Kläger stützte seine Klage im Wesentlichen darauf, dass die Backenzähne nicht als ganze (in toto) hätten entfernt werden dürfen, zumal dem Tierarzt habe bekannt sein müssen, dass die Knochensubstanz schon angegriffen gewesen sei. Durch die Extraktion der Zähne sei die Fraktur im Unterkiefer verursacht worden. Die Zähne hätten gespalten werden und dann mittels einer Zange gezogen werden müssen. Über diese Möglichkeit hätte der Kläger aufgeklärt werden müssen.
Das Gutachten
Der Sachverständige, der vom Gericht mit der Beurteilung des Sachverhaltes aus veterinärmedizinischer Sicht beauftragt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass die Beseitigung der beiden Backenzähne (P 2 und P 3) nach dem Röntgenbild erforderlich gewesen sei. Der Gutachter hielt es nicht für falsch, dass die Zähne nicht gespalten und mit einer Zange gezogen worden seien. Der beklagte Tierarzt hatte die Zähne "ausgestempelt", also ein, Loch in den Knochen über der Wurzel gebohrt und den Zahn dann vorsichtig herausgeschlagen. Das Ausstempeln der Zähne sei nach seiner Auffassung, so der Gutachter, eine schnelle, saubere und vertretbare Maßnahme.
Zur Aufklärungspflicht
Das Gericht vertrat die Auffassung, dass der Kläger nicht darüber aufzuklären war, dass es eine alternative Methode zur Entfernung der Zähne gegeben habe. Eine Aufklärungspflicht des Tierarztes gegenüber dem Eigentümer bestehe lediglich insoweit, als gleichermaßen effektive und medizinisch indizierte Behandlungsmethoden zur Verfügung stünden, welche für das Tier mit unterschiedlichen Risiken verbunden seien. Im konkreten Fall jedoch sei die Spaltung der Zähne keine angemessene, medizinisch indizierte alternative Methode gewesen, zumal nicht schonender als das Ausstempeln der Zähne.
Das LG ließ auch das Argument des Klägers nicht gelten, er habe über das Risiko einer Fraktur des Unterkiefers bei der Extraktion der Backenzähne "in toto" und das Risiko einer Infektion aufgeklärt werden müssen. Das LG verneinte einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der unterbliebenen Aufklärung und dem eingetretenen Schaden, nämlich der Unterkieferfraktur und einer anschließenden Fistelbildung, die zur Euthanasie des Pferdes geführt hatte.
Nach Auffassung des LG war es schon gar nicht nachgewiesen, dass die vom Tierarzt gewählte Art der Extraktion ursächlich geworden war für den Kieferbruch.
Bezüglich des Risikos einer Infektion verneinte das LG eine Aufklärungspflicht des Tierarztes. Ohnehin sei - so das LG in Übereinstimmung mit der anderweitigen Rechtsprechung - die Aufklärungspflicht des Tierarztes mit der Risikoaufklärung in der Humanmedizin nicht zu vergleichen. Über das Infektionsrisiko nach einer Operation bei einem Pferd müsse aber ohnehin nicht aufgeklärt werden, da allgemein bekannt sei, dass es im Rahmen von Operationen zu Infektionen kommen könne. Zudem hätte ja auch die Aufklärung an dem weiteren Verlauf nichts geändert. Ohnehin hätten die Zähne entfernt werden müssen. Der Kläger hätte sich mit Sicherheit nicht für die Unterlassung dieser Maßnahme entschieden, wenn der Tierarzt ausdrücklich auf das allgemein bestehende Infektionsrisiko hingewiesen hätte.
Fazit
Die Aufklärungspflicht des Tierarztes über Risiken der von ihm gewählten Behandlungsmethode ist deutlich von der des Humanmediziners zu unterscheiden. Das erklärt sich allein schon aus der unterschiedlichen Wertigkeit der betroffenen Rechtsgüter. Es macht insoweit einen erheblichen Unterschied, ob es um Leid und Leben eines Menschen oder um die Erhaltung eines "Wirtschaftsgutes" geht. Zudem dient die Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten in erster Linie dazu, eine Grundlage für eine wirksame Einwilligung in einen geplanten Eingriff zu schaffen. Nur der aufgeklärte Patient kann abwägen, ob er die Risiken eines bestimmten Eingriffs in Kauf nehmen möchte oder nicht. Gegenüber dem Pferdeeigentümer besteht dann eine Aufklärungspflicht, wenn der Tierarzt eine ihm persönlich Erfolg versprechender erscheinende Methode wählen möchte, die mit einem höheren Risiko verbunden ist als eine andere. Dann nämlich hätte der Patientenbesitzer, also der Pferdehalter, die Entscheidungsmöglichkeit, abweichend von der Einschätzung des Tierarztes die risikoärmere Methode zu wählen, auch wenn die geringere Erfolgsaussichten böte. Allerdings ist insoweit der Pferdeeigentümer in vollem Umfang beweispflichtig, nämlich für die Verletzung der Aufklärungspflicht und dafür, dass diese Pflichtverletzung letztlich ursächlich geworden ist für die Entstehung des behaupteten Schadens.
Dr. Dietrich Plewa